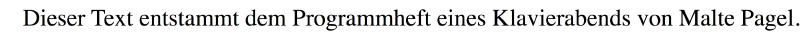


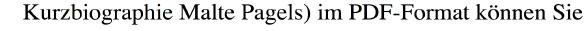



Das Online-Lexikon Wikipedia erklärt den Begriff Repetition (in musikalischen Zusammenhängen) als "das wiederholte Anschlagen derselben Taste auf einer Klaviatur". Klanglich sind das moderne Klavier und sein älterer Verwandter, das Cembalo, durchaus dafür geeignet, da ihr Ton schnell anspricht und der Beginn des jeweiligen Tons deutlich erkennbar ist. Die technische Realisierung zumindestens schneller Repetitionen ist auf einer Klaviatur jedoch - im Gegensatz zu Zupfinstrumenten, neben deren Saiten in allen Richtungen freier Raum ist - schwierig, da der Spieler erst den Finger zurückziehen und dann warten muß, bis die Taste in die Ausgangsposition zurückgekehrt ist. (Die verschiedenen Versuche der Instrumentenbauer, dem Pianisten die Arbeit zu erleichtern, sollen hier nicht erörtert werden.) Während auf anderen Instrumenten wie der Mandoline die Repetition das Standardmittel zur Verlängerung des Tons ist, stellt sie auf Tasteninstrumenten eine spieltechnische wie kompositorische Herausforderung dar, der sich verschiedene Komponisten mit Neugier und Entdeckerlust gestellt haben.
Als Domenico Scarlatti 1719 seine italienische Heimat für immer verließ, war das Tätigkeitsfeld eines Tasteninstrumentalisten ein anderes als heute. Das Hammerklavier, Vorläufer des modernen Flügels, war gerade erst erfunden und noch nicht so recht in Mode gekommen, und obwohl es zahlreiche konzertante Cembalowerke gab, erwartete man von einem Clavicenisten nicht deren Wiedergabe in Klavierabenden, sondern, daß die Möglichkeit, mehrere Töne gleichzeitig zu spielen, sein musikalisches Vorstellungsvermögen geprägt hatte: Ein Tasteninstrumentalist sollte Begleitungen improvisieren, Orchesterwerke skizzieren und Ensembleproben leiten (und dabei die Stimmen der schwänzenden Musiker auf seinem Instrument andeuten) können. Scarlatti hatte all diese Dinge gelernt und sich darin einen guten Ruf erworben - aber es interessierte ihn nicht wirklich; er wollte einfach nur den ganzen Tag lang auf seinem Cembalo spielen und empfand sich dabei als One-Man-Band. Dieser Begriff aus einem Paul-Simon-Song ist gar nicht so unpassend gewählt, wie es auf den ersten Blick erscheint, denn anders als Franz Liszt, der sich im 19. Jahrhundert als einköpfiges Orchester verstand, liebte Scarlatti ganz besonders die traditionsreiche, aber nicht durch Musiktheorie vorbelastete Folklore Portugals und Spaniens, wohin er emigriert war. Die oben angedeuteten spieltechnischen Herausforderungen nahm er an, und so wurde sein Cembalo zur Gitarre, ach was, zu zwei Gitarren, der Mann war schließlich Virtuose, und wenn er noch ein oder zwei Finger frei hatte, grüßen aus der Ferne Kastagnetten, gelegentlich aber auch italienischer Gesang oder deutsche Mehrstimmigkeit. Daß Scarlattis Werk nicht nur klaviertechnisch, sondern in erster Linie musikalisch bedeutsam ist, zeigt sich unter anderem daran, daß es in unserer Zeit nicht nur von Cembalisten und Pianisten, sondern auch von Akkordeonisten und Gitarristen (der ursprünglichen Inspirationsquelle) ins Repertoire aufgenommen wird.
Eine der auffälligsten Eigenschaften Ludwig van Beethovens war sein übergroßes Selbstbewußtsein. Wenn er sich mit einem musikalischen Gedanken befaßte, konnte man sicher sein, daß er sich mit nichts Geringerem als einer alles umfaßenden Abhandlung zufriedengab, die weitere Erörterungen überflüßig machte - jedenfalls in seinen Augen. (Die Sonate Es-Dur op. 7, in der verschiedenste Möglichkeiten von Tonwiederholungen als Ausgangspunkt für musikalische Entwicklungen dienen, ist für damalige Verhältniße außergewöhnlich lang; erst Jahrzehnte später hat er mit der sogenannten Hammerklaviersonate seinen eigenen Rekord übertroffen.) Beethoven vermeidet, mit der Tür ins Haus zu fallen und das Interesse seines Publikums vorschnell abstumpfen zu laßen: In den Ecksätzen treten die Repetitionen (zunächst) unauffällig in den Begleitstimmen auf - ein sanftes Pulsieren statt eines grellen Effekts. Der Lohn dieser verhaltenen Vorgehensweise ist die verblüffende Wirkung der Stellen, an denen der pulsierende Motor verstummt, aus choralartigen Allerweltsmelodien werden hier Großereignisse, die die Zeit stehenzulassen scheinen. Natürlich hat Beethoven noch mehr Tricks auf Lager, deutlich erkennbare und gut versteckte, die aber alle eines gemeinsam haben: es handelt sich um Tricks, die einem dramaturgischen Zweck innerhalb des Stücks dienen, zu eng mit diesem verbunden, als daß sie weggelassen werden könnten, aber auch nicht so eigenständig behandelt, daß sie wirklichen Einfluß auf den Ablauf nehmen dürfen.
Viele Komponisten befürchten, daß ihnen irgendwann die Ideen ausgehen; solche Gedanken waren Franz Schubert, der innerhalb eines Jahrzehnts eine kaum überschaubare Zahl an Werken voller origineller thematischer und formeller Einfälle schuf, fremd. Schuberts Problem war seine Unentschlossenheit; kaum hatte er sich dafür entschieden, eine Richtung einzuschlagen, trauerte er den verpaßten Möglichkeiten aller anderen Richtungen nach. (Das ist kein wie auch immer gearteter Mangel an Qualität, sondern eine Charaktereigenschaft; zu Schuberts Zeit wurde sie als Nachteil ausgelegt, im zwanzigsten Jahrhundert begann man sie als Tugend zu begreifen). Die oftmalige Wiederholung einzelner Töne, manchmal auch ganzer Passagen, kann man als ständiges Hinterfragen des zuvor Erklungenen begreifen, als Versuch, das bereits Gesagte durch kleine, kaum wahrnehmbare Veränderungen in einen anderen Zusammenhang zu stellen und somit aus einer anderen Perspektive zu sehen. Manche Theoretiker ordnen die Tatsache, daß das Impromptu op. 90,2 in Dur beginnt, aber in Moll endet (was wirklich ungewöhnlich ist), auch unter diesen Aspekt ein; die klügsten unter ihnen können überzeugend nachweisen, daß Schubert der erste Komponist gewesen sein muß, der diesen verstörenden Kunstgriff anwandte. Einziger Schönheitsfehler dieser scharfsinnigen Argumentation ist, daß ein gewisser Domenico Scarlatti sich der Brillanz des Gedankengangs nicht beugen wollte und mit der Sonate K297 (dem fünften Stück des Abends) rund ein halbes Jahrhundert vor Schuberts Geburt ein Werk schuf, daß auch in Dur beginnt und in Moll endet - vermutlich ganz ohne dialektische Absichten. Mitunter scheitern Versuche, die Welt zu erklären, an der hartnäckigen Theorieresistenz besagter Welt.
Ein Wort zu Arnold Schönberg vorweg: Auch wenn manche Menschen deswegen meine geschmackliche Kompetenz in Zweifel ziehen werden - ich spiele die 6 kleinen Klavierstücke op. 19 nicht wegen der darin enthaltenen geistigen Anforderungen, sondern weil ich sie schön finde. Obwohl Schönberg im wirklichen Leben als eher konservativ galt, polarisiert er nach wie vor wie ein zeitgenössischer Bürgerschreck; für die einen ist er ein Held, der die Musikgeschichte von überkommenen romantischen Klangidealen erlöst hat, für die anderen ein Schmierfink, der unsere schöne Musiziertradition zerstört hat und dem mißtönenden Blödsinn der Neuen Musik Tür und Tor geöffnet hat. Gestritten wird dabei meist über das Kompositionsverfahren "Zwölftonmusik", deren erster Protagonist Schönberg war, nicht über die Qualität seiner Werke selbst (man stelle sich das in einer anderen Stilrichtung vor: "Mozart war eine Genie, weil er Durakkorde zu kombinieren verstand!" - "Nein, im Gegenteil, gerade die Durakkorde weisen ihn als Stümper aus!"). Wie dem auch sei - Schönberg wurde nicht als Zwölftonkomponist geboren, und Opus 19 ist keine Zwölftonmusik. Er begann relativ traditionell, die kleinen Klavierstücke fallen in eine Periode der Suche nach neuen Ausdrucksformen für das, was ihm vage vorschwebte, bis er schließlich zur heißdiskutierten Kompositionstechnik fand. Der Versuch, diese Stückchen zu verstehen, stößt auf die gleiche Schwierigkeit, die bei jeder Musik auftritt, die keinem im Vorfeld bekannten Kompositionsverfahren folgt: eine solche Musik muß sich selbst erklären (vergleichbar mit Fremdsprachenunterricht, der von Anfang an ausschließlich in der fremden Sprache abgehalten wird). Für op. 19 hat die Musikwissenschaft den Begriff "Zentralklang" geprägt, was heißen soll, daß an die Stelle des Grundtons, auf den sich in tonaler Musik alles bezieht, ein komplexes Klanggebilde tritt. Im 2. und im 6. Stück ist das deutlich zu hören, wenn ein und derselbe Akkord immer wieder angeschlagen wird; der Aufbau der anderen Stücke ist komplizierter (zumindestens dauert es länger, sie zu erläutern, als sie zu spielen). Am besten hört man sie ohne theoretisierende Hintergedanken als Reisen in fremde Klangwelten. Falls sie Ihnen trotz meiner Werbung für diese Musik nicht gefallen sollten, trösten Sie sich - die Dinger sind kurz.
Nach den hochgeistigen Überlegungen zurück zur Nachahmung anderer Instrumente! Zeit seines Lebens hat Béla Bartók ausnotierte westliche (im Volksmund: klassische) Musik mit Volksmusik seiner osteuropäischen Heimat zu verbinden versucht; letztere zeichnet sich durch üppige Verwendung von Schlaginstrumenten aus. Obwohl ein Pianist durch verschiedene Anschlagsarten (innerhalb gewisser Grenzen) Klangfarben mancher Instrumente imitieren kann, ist das Klavier mit Schlagwerk schlicht überfordert: (Ungestimmte) Trommeln oder Becken - genauer: Instrumente, deren Schwingungserzeuger sich in mehr als eine Dimension in erwähnenswerter Weise erstreckt - produzieren helle, dunkle, lange, kurze, scharfe oder weiche Geräusche, aber eben Geräusche, denen keine bestimmte Tonhöhe zugeordnet werden kann, und genau das ist Sinn der Sache. Ein Klavierton dagegen ist, unabhängig von seiner Klangfarbe, immer ein bestimmter Ton. Bartók löst dieses Problem gleichermaßen rabiat wie eindrucksvoll, indem er ein und denselben Ton (oder Akkord) ständig wiederholen läßt (selbst dann unverändert, wenn die Harmonie wechselt), bis der Zuhörer dessen Tonhöhe ignoriert und sich nur noch auf den Rhythmus und die Klangfarbe des repetierten Tons konzentriert - voilà, das Vorzeigeinstrument des akademischen Musikbetriebs wird zur Kapelle, die zum Tanz auffordert.
Malte Pagel
copyright: Malte Pagel